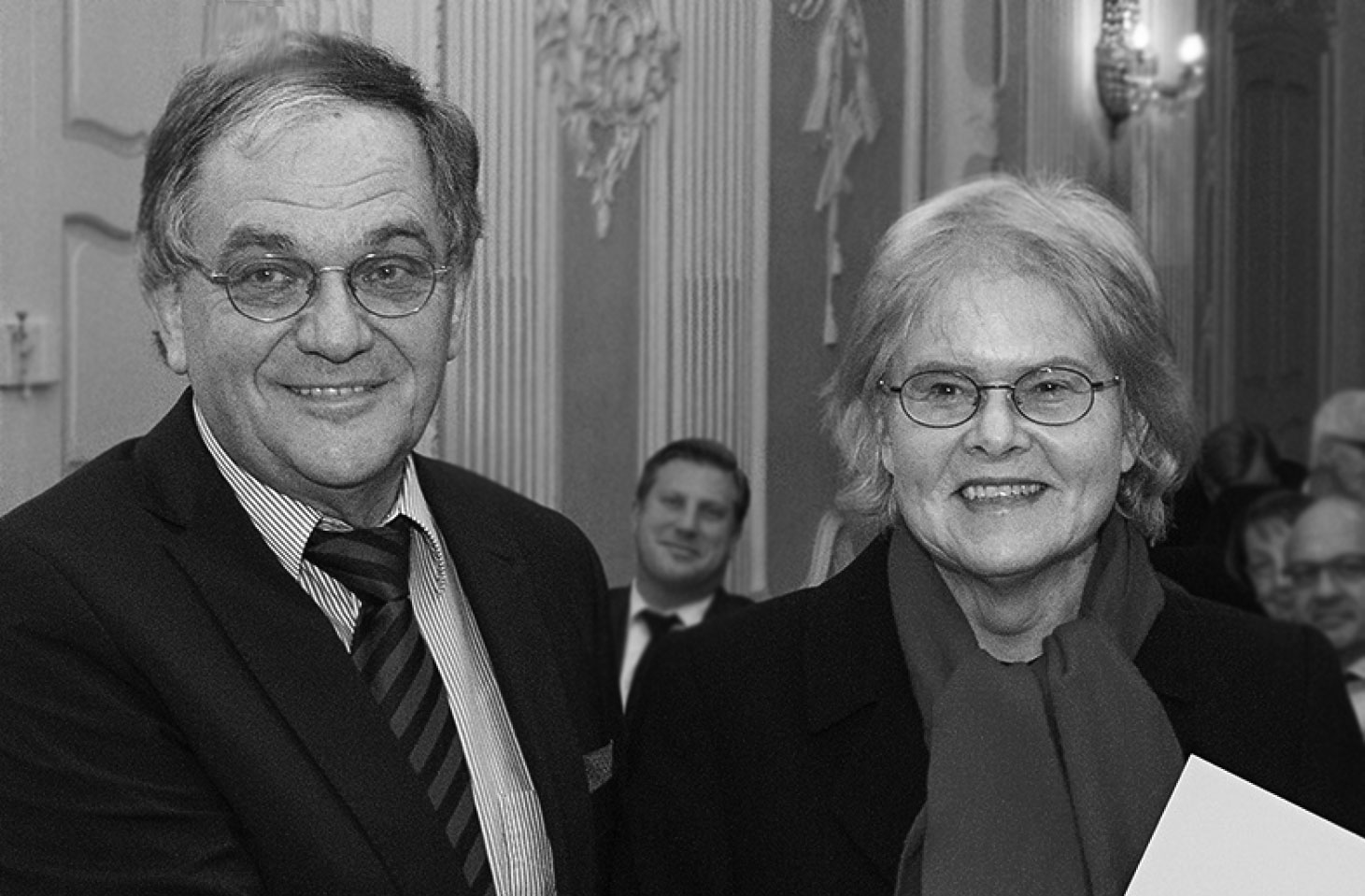Wie es zum Otto Kirchheimer-Preis kam
… eine 49-jährige Geschichte
Wie es zum Otto Kirchheimer-Preis kam
… eine 49-jährige Geschichte
Wie es zum Otto Kirchheimer-Preis kam
… eine 49-jährige Geschichte
Sehr geehrter Herr Schulze,
sehr geehrter Herr Professor Meyers,
sehr geehrter Herr Professor von Alemann,
sehr geehrter Herr Professor Wiesendahl,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
wie es zu dem Otto Kirchheimer-Preis kam: eine 49-jährige Geschichte, die es kurz zu erzählen gilt.
Die Geschichte hat etwas mit einem jungen, politisch interessierten Mann zu tun, der im Sommersemester 1965 in Tübingen mit dem Jurastudium begann, nicht aus Überzeugung, sondern freiwillig einer väterlichseits bestehenden Familientradition folgend.
Zu Beginn meines Studiums versuchte ich zu verstehen, warum es zu fast jeder Rechtsfrage eine subjektive, eine objektive und eine vermittelnde Theorie gab.
Ich verstand nicht, mit welcher Ernsthaftigkeit und Verbissenheit, Verbalinjurien eingeschlossen, sich angesehene Professoren mit ihren Kollegen auseinandersetzten.
In Tübingen lehrte Jürgen Baumann Strafrecht. Im Mittelpunkt der Tat stand für ihn die kausale Rechtsgutverletzung. Sein Widerpart, Hans Welzel in Bonn, entwickelte einen personalen Unrechtsbegriff: Die Tat als solche stellt noch keine Schuld dar, sondern erst der Wunsch und der Wille, Straftaten zu begehen. Die strafrechtlichen Konsequenzen sind nach beiden Theorien identisch.
Im Wintersemester 1966/1967 wechselte ich an die Universität Bonn. In meiner Scheinesammlung fehlte noch der große Strafrechtsschein. Meine größte Sorge war, ob ich als „Baumann-Schüler“ diesen Schein bei Welzel überhaupt erlangen könne.
Ich empfand dies als ätzend. Die Rechtswissenschaft erschien mir wie eine Wissenschaft l’art pour l’art. Damit konnte ich nichts anfangen. Vielleicht floh ich deshalb in die Studentenpolitik.
Innerhalb weniger Monate wurde ich Vorsitzender der Hochschulgruppe des Sozialdemokratischen Hochschulbundes (SHB) an der Universität Bonn, Mitglied des Studentenparlaments, Mitglied des Bonner AStA als Referent für Öffentlichkeitsarbeit, Fachschaftssprecher der Fachschaft Jura an der Universität Bonn, Bundesgeschäftsführer des SHB, Geschäftsführender Redakteur von „frontal“, der Zeitung des SHB und wenig später Vorsitzender des Fachverbandes Rechtswissenschaft im VDS, dem Verband Deutscher Studentenschaften.
In den Augen wohlmeinender Kommilitonen war das Amt des Bundesgeschäftsführers ein Schleudersitz. Die SPD hatte sich gerade vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund getrennt und für die Gründung des SHB als eines handzahmen, parteinahen Studentenverbandes gesorgt.
Die in den SHB gesetzten Erwartungen erfüllten sich nicht. Eine außerordentliche Bundesdelegiertenkonferenz des SHB im Januar 1967 in Duisburg forderte die völkerrechtliche Anerkennung der DDR ohne Anführungszeichen, was im diametralen Widerspruch zur offiziellen Parteilinie stand.
Doch ich schweife ab.
Studentische Hochschulpolitik in den 66er, 67er und 68er Jahren war von Inhalten geprägt. Die politische Diskussion fand auf hohem Niveau statt. Dies war kein Zufall. Die einschlägigen Publikationen und Bücher hat man gelesen und konnte die Argumentationslinien in jeder Diskussion abrufen.
Bei vielen Studenten war Ausgangspunkt einer Politisierung Georg Pichts „Die Deutsche Bildungskatastrophe“. Zum politischen Handgepäck gehörte „Hochschule in der Demokratie“ von Nitsche, Gerhardt, Offe und Preuß. Und im Vorfeld des Schahbesuchs Bahman Nirumands „Persien, Modell eines Entwicklungslandes“. Karl D. Bredthauer, Redakteur der „Blätter für deutsche und internationale Politik“, hat mir Otto Kirchheimer als Lektüre empfohlen. Es waren zwei Bändchen der edition suhrkamp, in blau die Nr. 95 „Politik und Verfassung“, hellgelb die Nr. 222 „Politische Herrschaft – Fünf Beiträge zur Lehre vom Staat“. Startauflage übrigens 8 000 und 10 000 Exemplare: heute, im Zeitalter von Mails und Apps und Facebook und was es sonst noch gibt, undenkbar.
Die Lektüre brachte mir die Erkenntnis, dass Recht nicht nur Gegenstand wissenschaftlicher Theorien, sondern auch relevant für die demokratische, soziale und gerechte Entwicklung einer Gesellschaft sein kann.
In dem Aufsatz „Weimar – und was dann? Analyse einer Verfassung“ beschreibt Otto Kirchheimer den Antagonismus zwischen den Normen der Verfassung und den realen gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Es ist die Dialektik zwischen Macht und Recht.
Bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse können mit einer Verfassung, welche diese Strukturen rechtlich absichert, kaum geändert werden. Eine fortschrittliche Verfassung eröffnet aber die Chance für einen gesellschaftlichen Wandel. Wer sich in der politischen Diskussion über die Notwendigkeit von Reformen auf die Verfassung berufen konnte, hatte einen gewichtigen Argumentationsvorteil.
Und plötzlich war für mich Recht eine spannende Materie.
Im November 1966 gab es in Deutschland die erste Große Koalition. Ich erinnere mich noch genau an eine Demo vor der legendären SPD-Baracke in Bonn. Ich war empört und anschließend sprachlos, wobei die Sprachlosigkeit auch auf einen grippalen Infekt und eine schlimme Erkältung zurückzuführen war, die ich mir auf der Demo einfing. Es war kalt, wir Demonstranten standen im Schneematsch, Schneeregen und kalter Wind konnten den Widerstand gegen die Große Koalition aber nicht brechen.
Ich bin mit 19 Jahren 1964 in die SPD eingetreten, weil sie für mich die Partei der Freiheit war, die Partei des Friedens, die mit ihrem Deutschlandplan Ende der 50er Jahre den Kalten Krieg beenden und die nationale Einheit herstellen wollte. Die SPD war für mich die Partei der sozialen Gerechtigkeit, die Partei der einfachen Menschen und der Gleichberechtigung von Mann und Frau, eine Partei, die den sozialen Rechtsstaat verwirklicht und Artikel 14 Abs. 3 GG ernst nimmt.
Und das alles mit der CDU? Gibt die SPD ihr Ziel auf, mit diesem Regierungswechsel einen Politikwechsel zu erreichen?
Otto Kirchheimer beschrieb diese Entwicklung in seinen beiden Aufsätzen „Deutschland oder Der Verfall der Opposition“ und „Wandlungen der politischen Opposition“ und rechnete gnadenlos mit der Politik der SPD nach Godesberg ab. Opposition sei zu einer taktischen Angelegenheit geworden, Weltanschauungsparteien auf der Grundlage konfessioneller oder klassenstruktureller Basis entwickeln sich zu entideologisierten Parteien, die austauschbar sind. Das Charisma der Spitzenkandidaten sei wichtiger als politische Inhalte und Alternativen.
Die Entpolitisierung von Parteien, die Entpolitisierung der Politik und die Verrechtlichung der Politik hat Otto Kirchheimer schon damals beschrieben.
Haben mich die Große Koalition und die schonungslosen Analysen von Otto Kirchheimer entmutigt, mich weiter in der SPD zu engagieren? Nein, überhaupt nicht. Wenn man etwas ändern will, muss man sich engagieren.
Ich tat dies, als Vorsitzender der Jungsozialisten im Unterbezirk Rhein-Sieg, als 1. stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Rhein-Sieg, als Mitglied des Gemeinderates der Stadt Sankt Augustin und als Mitglied des Kreistages des Rhein-Sieg-Kreises.
Im Jahre 1984 wurde ich zum Bürgermeister in Heilbronn gewählt und lernte Otto Kirchheimer auf einer ganz anderen Ebene kennen. Otto Kirchheimer wurde in Heilbronn geboren, emigrierte als Jude 1938 in die USA und wurde auf seinen Wunsch hin auf dem Jüdischen ‚Friedhof „Im Breitenloch“ beerdigt. Dies hat mich tief beeindruckt, musste aber auch feststellen, dass er im kollektiven Gedächtnis der Stadt keine Rolle mehr spielt. Dabei ist Otto Kirchheimer einer der bedeutendsten Söhne der Stadt.
Wenn man die politische Entwicklung seit 1965, dem Todesjahr von Otto Kirchheimer, betrachtet, kann man nur staunen, welche Entwicklungen er vorausgesehen hat:
- Austauschbarkeit von Parteien
- Rapid sinkende Mitgliederzahlen
- Rückgang innerparteilicher Demokratie
- Funktionsverlust der Volksparteie
- Politikverdrossenheit
- Glaubwürdigkeit der politischen Akteure
- sinkende Wahlbeteiligung, insbesondere im kommunalen Bereich
- Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie
Verliert die Demokratie ihre Legitimation? Geht der Demokratie das Volk verloren?
In den letzten Jahren reifte immer mehr der Gedanke – von meiner Frau Gudrun unterstützt – einen Otto Kirchheimer-Preis auszuloben. Anlass dafür war die Verleihung des Ehrenringes des Stadt Heilbronn an mich. Der Dank an die Stadt für diese Auszeichnung ist der Otto Kirchheimer-Preis.
Und so gibt es nun den Otto Kirchheimer-Preis, der von meiner Frau und mir mit 10 000 € dotiert ist und alle zwei Jahre auf Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirates unter dem Vorsitz von Professor Dr. Dr. h. c. mult. Reinhard Meyers vom Förderverein Otto Kirchheimer-Preis e.V. verliehen wird.
Mit dem Preis soll an Otto Kirchheimer erinnert werden. Er soll einen Beitrag zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Arbeiten von Otto Kirchheimer zum Verhältnis von Sozialordnung, Staatsverfassung und politischer Gewalt sowie zum Funktionswandel der Parteien innerhalb der Parteiendemokratie leisten. Er soll auch Wissenschaftler würdigen, die sich mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit um die Demokratie – und Parteienforschung verdient gemacht oder mit ihren Forschungsergebnissen die Demokratie – und Parteienforschung mit neuen Erkenntnissen bereichert haben.
Erster Preisträger ist Professor Ulrich von Alemann.
Der erste Bundespräsident Theodor Heuss hat einmal gesagt, Demokratie bekommt man nicht wie frische Brötchen jeden Morgen vor die Haustüre gelegt. Recht hat er! Um Demokratie muss man kämpfen, man muss jeden Tag überzeugen, dass Demokratie, sozialer Rechtsstaat und eine freiheitliche Gesellschaftsordnung untrennbar miteinander verbunden sind. Auch dazu soll der Otto Kirchheimer-Preis beitragen.
So bleibt mir nur noch zu danken: meiner Frau Gudrun, die aus Überzeugung hinter dem Projekt steht, den Gründungsmitgliedern des Vereins und der Landesvertretung Baden-Württemberg als Ausrichter dieser Veranstaltung. Ich danke auch den Referenten des heutigen Abends, Professor Ulrich von Alemann, Professor Reinhard Meyers und Professor Elmar Wiesendahl.
Möge die Veranstaltung dazu beitragen, Otto Kirchheimer den Platz in der öffentlichen Wahrnehmung einzuräumen, den er verdient.